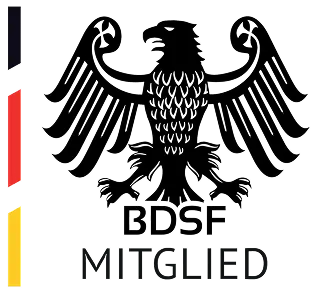


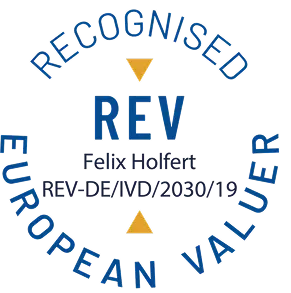
AfA-Rechner
Immobilienabschreibung einfach berechnen und Steuern sparen


Felix Holfert
Real estate appraiser according to DIN ISO 17 0 24


Felix Holfert
Welche Abschreibung ist bei Immobilien gesetzlich vorgesehen?
Für Wohngebäude mit Baujahr zwischen 1925 und 2022 gilt der lineare AfA-Satz von 2 Prozent pro Jahr, was einer regulären Nutzungsdauer von 50 Jahren entspricht. Ab Baujahr 2023 wurde der Satz auf 3 Prozent jährlich erhöht; die steuerliche Abschreibungsdauer verkürzt sich damit auf 33 Jahre. Der Gesetzgeber möchte damit den Neubau stärker fördern.
Verkürzte Abschreibung durch Restnutzungsdauergutachten
Wenn die tatsächliche Restnutzungsdauer eines Gebäudes kürzer ist als gesetzlich vorgesehen, können Sie per Gutachten eine höhere Abschreibung pro Jahr durchsetzen. So reduziert sich das zu versteuernde Einkommen deutlich schneller; und damit auch die Steuerlast.
Ob sich ein solches Gutachten für Ihr Objekt lohnt, lässt sich mit unserem AfA-Rechner für vermietete Immobilien einfach herausfinden. Er zeigt Ihnen, welche Steuerersparnis möglich ist und wie schnell sich die Investition in ein Gutachten amortisiert.
Einfach mal ausprobieren?
Geben Sie jetzt die individuellen Werte ihrer Immobilie ein und simulieren Sie in Echtzeit die Abschreibung Ihrer Immobilie.
Hauptgründe, die für AfA sprechen:
 Maximale Steuervorteile:
Maximale Steuervorteile:Mit AfA senken Sie die Steuerlast für vermietete oder gewerblich genutzte Immobilien und steigern Ihre Netto-Mietrendite.
 Planungssicherheit über Jahrzehnte:
Planungssicherheit über Jahrzehnte:AfA bietet nicht nur kurzfristige Entlastung, sondern ermöglicht eine präzise, langfristige Steuerplanung.
 Attraktiver für Investoren
Attraktiver für InvestorenImmobilien mit klar kalkulierbarer Abschreibung wirken interessanter auf Käufer und Geschäftspartner.
 Wert beim Verkauf:
Wert beim Verkauf:Selbst bei einem Immobilienverkauf können Käufer den verbleibenden Abschreibungszeitraum übernehmen: ein zusätzlicher Vorteil.

AfA für Immobilien: das Wichtigste auf einen Blick
Wer eine vermietete Immobilie kauft, kann die Anschaffungskosten, also den Gebäudeanteil und bestimmte Nebenkosten, nicht jedoch den Grundstückswert, über viele Jahre steuerlich abschreiben. Das reduziert Jahr für Jahr die Steuerlast.
Grundlagen der AfA
Die Absetzung für Abnutzung spiegelt den natürlichen Wertverlust einer Immobilie wider. Vermieter dürfen diesen rechnerischen Verlust steuerlich geltend machen und so ihren zu versteuernden Gewinn senken.
Für Wohngebäude gelten feste Sätze:
Baujahr 1925 bis 2023 → lineare Abschreibung mit 2 Prozent pro Jahr bei einer Nutzungsdauer von 50 Jahren.
Baujahr ab 2023 → 3 Prozent pro Jahr bei einer Nutzungsdauer von 33 Jahren und 4 Monaten.
Möglichkeit zur schnelleren Abschreibung
Ein Gutachten, das eine kürzere Restnutzungsdauer bestätigt, ermöglicht eine höhere jährliche Abschreibung. Dadurch werden Anschaffungskosten schneller steuerlich wirksam und die Steuerlast sinkt früher. Ein AfA Rechner zeigt, wie hoch die jährliche Ersparnis ausfallen kann.
Was zu den Anschaffungskosten gehört
Für die AfA zählt nicht nur der Kaufpreis des Gebäudes, sondern auch alle erwerbsbezogenen Nebenkosten, die auf das Gebäude entfallen, wie zum Beispiel:
Der Grundstückswert wird bei der Berechnung immer herausgerechnet.
So wird gerechnet
Formel:
(Gebäudepreis plus anrechenbare Nebenkosten) geteilt durch Nutzungsdauer = jährlicher Abschreibungsbetrag
Beispiel:
Eine Immobilie kostet 360.000 Euro, wovon 80.000 Euro auf das Grundstück entfallen. Die Kaufnebenkosten liegen bei 40.000 Euro. Damit ergibt sich ein anrechenbarer Betrag von 320.000 Euro. Bei einer Nutzungsdauer von 50 Jahren beträgt die jährliche Abschreibung 2 Prozent, also 6.400 Euro.
Fazit
Die AfA ist ein wirksames Steuerinstrument für Vermieter. Wer die Möglichkeit einer verkürzten Nutzungsdauer nutzt, erhöht den jährlichen Abschreibungsbetrag und profitiert schneller von spürbaren Steuerentlastungen.
Was kostet ein Nutzungsdauergutachten?
Kostenlose ErsteinschätzungFaire Preise - keine versteckten Zusatzkosten
Bei uns kostet ein Nutzungsdauergutachten ab 950,00 € brutto (798,32€ netto) - bis zu einer Größe von 150m2. Danach steigt der Preis - nach Größe - leicht an.
Zusatzkosten durch Besichtigung
Optional - und von uns empfohlen - können Sie eine Besichtigung dazubuchen, um die Wertigkeit Ihres Gutachtens zu erhöhen.
Preisliste
Die finalen Kosten Ihres Gutachtens entnehmen Sie unserer Preisliste. Preisliste