Unverbindliches Angebot / Einschätzung
Ihre Sachverständigen prüfen kostenlos, ob sich ein Gutachten für Sie lohnt. Sie erhalten eine unverbindliche Ersteinschätung.
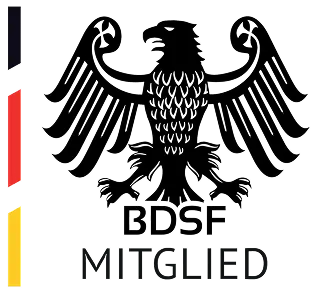


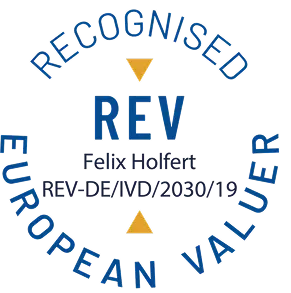


Real estate appraiser according to DIN ISO 17 0 24


Ein Nutzungsdauergutachten ist ein fachlich fundierter Nachweis über die tatsächliche wirtschaftliche Lebensdauer eines Gebäudes. Es wird von einem zertifizierten Sachverständigen erstellt und berücksichtigt Baujahr, Modernisierungen, baulichen Zustand und die zu erwartende Instandhaltungsintensität. Mit diesem Gutachten können Eigentümer gegenüber dem Finanzamt belegen, dass die pauschale 50-jährige Nutzungsdauer nicht zutrifft. Dadurch wird eine höhere jährliche Abschreibung möglich - gesetzeskonform, transparent und nachvollziehbar. Für Eigentümer bedeutet das: geringere Steuerlast, höhere Liquidität und langfristig ein besserer Cashflow.
Erhöhen Sie Ihre Abschreibungen gezielt mit einem professionellen Nutzungsdauergutachten.
Sparen Sie Steuern mit smarter Abschreibung – spürbar mehr Geld im Jahr.
Anerkannte Gutachten von DIN ISO/IEC 17024 Experten – finanzamtskonform.
Ein Immobiliengutachten muss nicht kompliziert sein. Bei uns starten Sie mit einer kostenfreien Ersteinschätzung – ohne Verpflichtung, aber mit maximaler Transparenz. So wissen Sie von Anfang an, was sinnvoll und wirtschaftlich ist.
Kostenlose ErsteinschätzungIhre Sachverständigen prüfen kostenlos, ob sich ein Gutachten für Sie lohnt. Sie erhalten eine unverbindliche Ersteinschätung.
Ihre Sachverständigen prüfen jede Anfrage individuell im Detail - um Ihre Daten zu plausibilisieren und Ihre Ziele zu erreichen.
Sie bekommen Ihr individuell erstelltes Gutachten - als verlässliche Grundlage für Ihre nächsten Schritte.
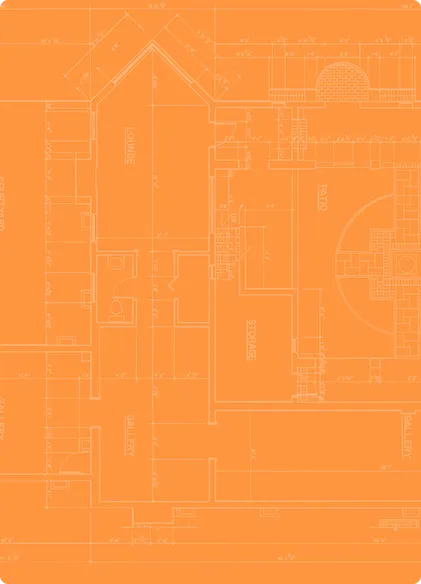

(inkl. MwSt)
(inkl. MwSt)
(inkl. MwSt)
In Deutschland werden die meisten vermieteten Immobilien pauschal über 50 Jahre abgeschrieben - unabhängig von Zustand oder Baujahr. In der Realität haben viele Gebäude jedoch eine deutlich kürzere Restnutzungsdauer, besonders ältere oder teilsanierte Objekte.
Genau hier setzt unser Nutzungsdauergutachten an. Es zeigt auf, wie lange Ihre Immobilie tatsächlich noch wirtschaftlich genutzt werden kann und dient als fundierte Grundlage gegenüber dem Finanzamt. So können Sie Ihre Abschreibung beschleunigen, Ihre Steuerlast senken und Ihre Rendite nachhaltig steigern.

Viele Eigentümer wissen gar nicht, dass sich durch eine verkürzte Restnutzungsdauer erhebliche steuerliche Vorteile ergeben können. Bereits wenige Jahre Unterschied machen einen deutlichen Effekt in der jährlichen Steuerbilanz aus.
Unsere nach DIN ISO/IEC 17024 zertifizierten Sachverständigen erstellen die Gutachten so, dass sie steuerlich anerkannt sind und reibungslos beim Finanzamt eingebracht werden können. Dabei legen wir größten Wert auf Nachvollziehbarkeit, Plausibilität und eine transparente Dokumentation aller Einflussfaktoren.

Die Art der Immobilie hat erheblichen Einfluss auf die Einschätzung der Restnutzungsdauer. Ob Einfamilienhaus, Eigentumswohnung oder Gewerbeeinheit - jeder Immobilientyp ist unterschiedlichen Nutzungsbelastungen und Abnutzungsfaktoren ausgesetzt. Diese Unterschiede werden im Nutzungsdauergutachten berücksichtigt und fließen direkt in die Bewertung der tatsächlichen Lebensdauer ein.
Das Baujahr liefert zentrale Hinweise zur Bauweise, zum verwendeten Material und zum typischen Verschleißverhalten einer Immobilie. Je älter das Gebäude, desto relevanter ist eine individuelle Einschätzung der Restnutzungsdauer. Ein professionelles Nutzungsdauergutachten bewertet genau diese Faktoren - und schafft so die Grundlage für eine fundierte steuerliche Optimierung.
Durchgeführte Modernisierungen beeinflussen die Restnutzungsdauer oft erheblich. Erneuerungen an Dach, Fassade, Fenstern, Heizung oder Bädern können die technische Lebensdauer verlängern und den baulichen Zustand verbessern. Diese Angaben fließen direkt in das Restnutzungsdauergutachten ein - und helfen dabei, eine realistische und steuerlich wirksame Einschätzung vorzunehmen.
Der bauliche Zustand einer Immobilie ist ein zentraler Faktor im Nutzungsdauergutachten. Schäden, Abnutzung oder Sanierungsbedarf verkürzen die Restnutzungsdauer - während ein gepflegter Zustand diese deutlich verlängern kann. Auch individuelle Besonderheiten wie Ausstattungsqualität oder energetische Sanierungen werden berücksichtigt und beeinflussen das Ergebnis des Gutachtens direkt.
echte Praxisbeispiele und überzeugende Ergebnisse.
Unsere Gutachten schaffen messbare Vorteile: Immobilienbesitzer sparen durch die reduzierte Nutzungsdauer jedes Jahr tausende Euro an Steuern. Ob Eigentumswohnung, Einfamilienhaus, Mehrfamilienhaus oder Gewerbeobjekt – wir zeigen Ihnen, wie Sie durch gezielte Abschreibungen Ihre Steuerlast deutlich senken können.
Kostenlose Ersteinschätzung


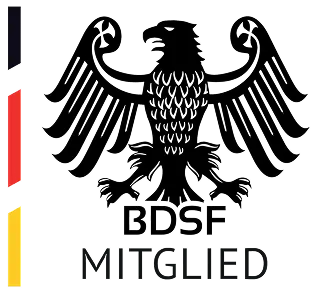


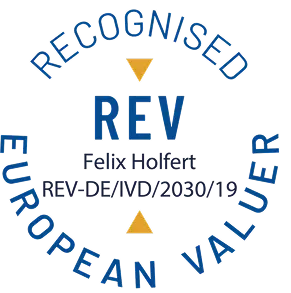


Real estate appraiser according to DIN ISO 17 0 24


Ein Nutzungsdauergutachten ist ein fachlich fundierter Nachweis über die tatsächliche wirtschaftliche Lebensdauer eines Gebäudes. Es wird von einem zertifizierten Sachverständigen erstellt und berücksichtigt Baujahr, Modernisierungen, baulichen Zustand und die zu erwartende Instandhaltungsintensität. Mit diesem Gutachten können Eigentümer gegenüber dem Finanzamt belegen, dass die pauschale 50-jährige Nutzungsdauer nicht zutrifft. Dadurch wird eine höhere jährliche Abschreibung möglich - gesetzeskonform, transparent und nachvollziehbar. Für Eigentümer bedeutet das: geringere Steuerlast, höhere Liquidität und langfristig ein besserer Cashflow.
Erhöhen Sie Ihre Abschreibungen gezielt mit einem professionellen Nutzungsdauergutachten.
Sparen Sie Steuern mit smarter Abschreibung – spürbar mehr Geld im Jahr.
Anerkannte Gutachten von DIN ISO/IEC 17024 Experten – finanzamtskonform.
Ein Immobiliengutachten muss nicht kompliziert sein. Bei uns starten Sie mit einer kostenfreien Ersteinschätzung – ohne Verpflichtung, aber mit maximaler Transparenz. So wissen Sie von Anfang an, was sinnvoll und wirtschaftlich ist.
Kostenlose ErsteinschätzungIhre Sachverständigen prüfen kostenlos, ob sich ein Gutachten für Sie lohnt. Sie erhalten eine unverbindliche Ersteinschätung.
Ihre Sachverständigen prüfen jede Anfrage individuell im Detail - um Ihre Daten zu plausibilisieren und Ihre Ziele zu erreichen.
Sie bekommen Ihr individuell erstelltes Gutachten - als verlässliche Grundlage für Ihre nächsten Schritte.
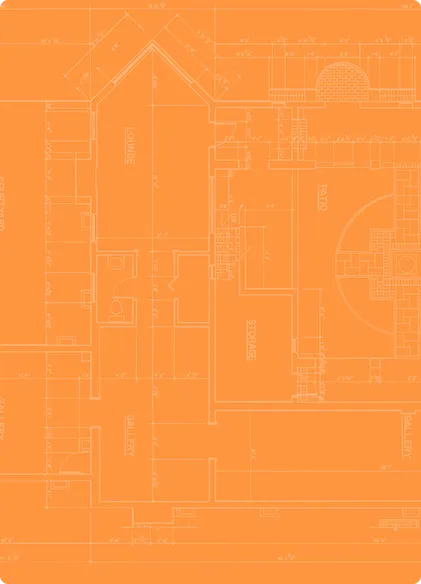

(inkl. MwSt)
(inkl. MwSt)
(inkl. MwSt)
In Deutschland werden die meisten vermieteten Immobilien pauschal über 50 Jahre abgeschrieben - unabhängig von Zustand oder Baujahr. In der Realität haben viele Gebäude jedoch eine deutlich kürzere Restnutzungsdauer, besonders ältere oder teilsanierte Objekte.
Genau hier setzt unser Nutzungsdauergutachten an. Es zeigt auf, wie lange Ihre Immobilie tatsächlich noch wirtschaftlich genutzt werden kann und dient als fundierte Grundlage gegenüber dem Finanzamt. So können Sie Ihre Abschreibung beschleunigen, Ihre Steuerlast senken und Ihre Rendite nachhaltig steigern.

Viele Eigentümer wissen gar nicht, dass sich durch eine verkürzte Restnutzungsdauer erhebliche steuerliche Vorteile ergeben können. Bereits wenige Jahre Unterschied machen einen deutlichen Effekt in der jährlichen Steuerbilanz aus.
Unsere nach DIN ISO/IEC 17024 zertifizierten Sachverständigen erstellen die Gutachten so, dass sie steuerlich anerkannt sind und reibungslos beim Finanzamt eingebracht werden können. Dabei legen wir größten Wert auf Nachvollziehbarkeit, Plausibilität und eine transparente Dokumentation aller Einflussfaktoren.

Die Art der Immobilie hat erheblichen Einfluss auf die Einschätzung der Restnutzungsdauer. Ob Einfamilienhaus, Eigentumswohnung oder Gewerbeeinheit - jeder Immobilientyp ist unterschiedlichen Nutzungsbelastungen und Abnutzungsfaktoren ausgesetzt. Diese Unterschiede werden im Nutzungsdauergutachten berücksichtigt und fließen direkt in die Bewertung der tatsächlichen Lebensdauer ein.
Das Baujahr liefert zentrale Hinweise zur Bauweise, zum verwendeten Material und zum typischen Verschleißverhalten einer Immobilie. Je älter das Gebäude, desto relevanter ist eine individuelle Einschätzung der Restnutzungsdauer. Ein professionelles Nutzungsdauergutachten bewertet genau diese Faktoren - und schafft so die Grundlage für eine fundierte steuerliche Optimierung.
Durchgeführte Modernisierungen beeinflussen die Restnutzungsdauer oft erheblich. Erneuerungen an Dach, Fassade, Fenstern, Heizung oder Bädern können die technische Lebensdauer verlängern und den baulichen Zustand verbessern. Diese Angaben fließen direkt in das Restnutzungsdauergutachten ein - und helfen dabei, eine realistische und steuerlich wirksame Einschätzung vorzunehmen.
Der bauliche Zustand einer Immobilie ist ein zentraler Faktor im Nutzungsdauergutachten. Schäden, Abnutzung oder Sanierungsbedarf verkürzen die Restnutzungsdauer - während ein gepflegter Zustand diese deutlich verlängern kann. Auch individuelle Besonderheiten wie Ausstattungsqualität oder energetische Sanierungen werden berücksichtigt und beeinflussen das Ergebnis des Gutachtens direkt.
echte Praxisbeispiele und überzeugende Ergebnisse.
Unsere Gutachten schaffen messbare Vorteile: Immobilienbesitzer sparen durch die reduzierte Nutzungsdauer jedes Jahr tausende Euro an Steuern. Ob Eigentumswohnung, Einfamilienhaus, Mehrfamilienhaus oder Gewerbeobjekt – wir zeigen Ihnen, wie Sie durch gezielte Abschreibungen Ihre Steuerlast deutlich senken können.
Kostenlose Ersteinschätzung

